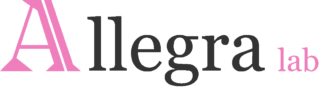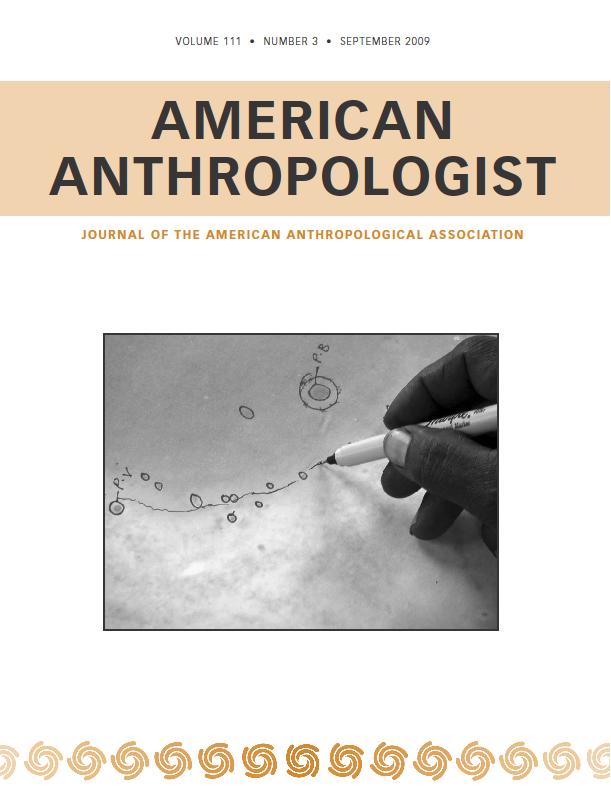The following paper [in German] was presented during the symposium ‘The Future of German Anthropology’ at the University of Leipzig, November 2014.
English abstract: Collaborative research. Anthropology as a travelling model of research practice and knowledge production
In this talk the notion of ‚travelling models’ serves as a basis for a future oriented, rigorously collaborative research practice and knowledge production in anthropology. Examples for this collaboration are drawn from Elisabeth Povinelli’s research with the Karrabing collective in Australia, Nina Glick Schiller’s and Georges Eugene Fouron’s study about Haitian transnationalism or the Comaroffs’ claim for taking theories from the south as a possibility for a critical and theoretical corrective to global inequalities as experienced and observed from a „southern“ perspective. Relating to this, ‘travelling models’ not only include the historical dimension of anthropological research, but also its ability to transform –itself and all those collaborating within a research project. Collaboration, along Povinelli’s example, then means to realise the collaborators’ „fundamental non-unity, but obligation to collaborate by having come together“. The paper develops the vision that this form of committed collaboration might produce the kind of knowledge that is not dominated by a preset and one-sided epistemology, but is able to produce the multifaceted insights into different knowledge systems, their respective constructions of arguments and the ways of providing evidence that reflect the merging of epistemologies. An adaptive model can incorporate these diverse backgrounds and interests, but it would need trust to share a common interpretational frame. Not all research allows for such a frame. Providing some recent research initiatives in German speaking environments, this paper concludes with the hope that anthropology can creatively produce the attention for such varying constructions of knowledge and relevance.
Ende Juli 2014 war ich auf der Tagung der European Association of Social Anthropologists (EASA) in Tallinn, wie vielleicht einige der hier Anwesenden. Die Tagung trug den Titel „Collaboration, Intimacy & Revolution – innovation and continuity in an interconnected world“. Elisabeth Povinelli, Franz Boas Professorin der Anthropologie und Gender Studies an der Columbia University in New York hielt den Keynotevortrag mit dem (geänderten) Titel „ Collaboration, alteration, investigation“, den sie, wie sie sagte, extra für diese Veranstaltung geschrieben hatte und der sie erstmals dazu gebracht hat, die wesentliche Verbindung von „Kollaboration“,„Veränderung“ und „Erforschung“ mit unserer Tätigkeit als Anthropologen in einen Zusammenhang zu stellen. Für mich war dieser Vortrag ein erstaunliches Erlebnis. Zum einen fand ich das Gehörte sehr inspirierend. Povinelli schien mir in Worte zu fassen, was ich ebenfalls seit einer Weile als bedeutend empfunden hatte – die Frage danach, wie genau es zur Zusammenarbeit mit den Personen kommt, mit denen wir forschen. Erstaunlich war aber auch die allgemeine Reaktion auf diesen Vortrag. Als ich, noch glücklich über die Inspiration den Raum verließ, schwappte mir eine Woge der Entrüstung entgegen: wütende Worte über die Unverschämtheit einen derart konfusen Vortrag zu halten, dazu noch als keynote, dreist und vollkommen unorganisiert, ohne klare Aussage …
Zugegeben, es war vielleicht nicht sehr geschickt von der Rednerin zu sagen, sie habe „eigentlich gar nicht zu der Tagung kommen wollen“, dass sie „normalerweise gar nicht mit Anthropologen zusammen arbeitet“ und vor allem hier sei „weil sie Estland noch nicht kannte“ – das ist einigermaßen frech, wenn man die Ehre erhält, den einleitenden Vortrag für eine große europäische Ethnologietagung zu halten, zumal wenn man selbst aus den USA kommt. Erstaunt war ich aber eben vor allem, weil die Art und Weise wie mich der Vortrag angeregt hatte, kaum auf Verständnis traf. Während der nächsten Tage wurde ich immer wieder von KollegInnen angesprochen mit der ungläubigen Frage: „Und dir hat das tatsächlich gefallen? Warum???“
Was hatte mir also gefallen? Bevor ich darauf das eingehe, möchte ich noch eine weitere kurze Geschichte erzählen, die wie ich finde auf die Zukunft der Ethnologie verweist. Vor einer Weile hatte mich Julia Eckert nach Bern eingeladen, um vor ihren Studierenden einen Vortrag über meine Forschung zu den sozialen Folgen der Erdölförderung im Tschad zu halten. Es ging um die nachteiligen Auswirkungen der Erdölproduktion auf das Land und die Bauern der Förderregion. In der lebhaften Diskussion nach dem Vortrag stellte ein Student die Frage: „ Was berechtigt uns eigentlich als Ethnologen in anderen Ländern zu forschen, darüber Theorien zu entwickeln und die Ergebnisse in unserer Wissenschaftswelt zu veröffentlichen?“ Meine Antwort blieb damals einigermaßen vage. Ich meinte, dass es nicht ausschließlich darum gehen kann, dass die Ergebnisse meiner Forschung „nützlich“ sind. Meine Antwort ging eher in die Richtung, dass es ein Bestreben sein könnte, zumal in meiner Arbeit in unterschiedlichen afrikanischen Zusammenhängen, diese Forschung „gemeinsam“ zu betreiben – das heißt, mit einheimischen ForscherInnen zusammen zu arbeiten, gemeinsam Wissen zu produzieren und, wenn möglich, weitergehende Kooperationen vorzubereiten.
Die Frage, die mich hier in diesem Vortrag beschäftigt ist also diese: Wie kann eine gleichberechtigte Kooperation im Zusammenhang eines Forschungsfeldes entstehen? Wie kann man dabei verhindern, dass eine bessere finanzielle Ausstattung sich darin äußert, nur die eigenen Herangehensweisen an die Forschung und damit die eigenen epistemologischen Voraussetzungen umzusetzen? Und wie lässt sich das „Verschweigen“ der Ko-Produktion von Daten und Theorien verhindern, das in zahlreichen postkolonialen Studien beklagt wird?
Ethnologie als Travelling Model
Ich komme gleich auf die Vorschläge von Elisabeth Povinelli (und einigen anderen) zurück. Zuvor einige kurze Überlegungen zu den im Titel genannten „Travelling Models“ in Hinsicht auf die gemeinsame Forschung und Wissensproduktion. Das Hauptargument dieses Ansatzes ist es, dass Modelle zwar (historisch) mit relativ festgelegten Vorstellungen über Herangehensweisen und Interpretationswege ausgestattet sind, dass sie aber in der jeweiligen Situation ihres Einsatzes kontextabhängig interpretiert und angewandt werden – und sich eventuell verändern können.
Das Konzept der „travelling models“ wurde von Richard Rottenburg in seinem Buch „Weit hergeholte Fakten“ (2002, 2009) entwickelt, um Prozesse der Veränderung auf einer globalen Ebene zu analysieren (siehe auch Behrends, Park & Rottenburg 2014). Ein Modell kann als eine analytische Repräsentation bestimmter Aspekte der Realität betrachtet werden, das dazu geschaffen wurde, in dieser Realität zu interagieren. Modelle – und die Vorstellungen über die Realität, die in ihnen liegen – treten als objektifizierte Formen auf, als Technologien, die in die Praxis umgesetzt werden. Indem Modelle von menschlichen Akteuren von einem Ort zu einem anderen transportiert werden, reisen sie. Am Ziel der Reise angekommen werden die in den Modellen liegenden Annahmen und Praktiken von unterschiedlichen Akteuren an eine neue Umgebung angepasst – sie werden übersetzt. Die Übersetzung oder „Translation“ – und das ist vielleicht der wichtigste Punkt – geschieht in sogenannten Zwischenräumen oder „interstitial spaces“. An dieser Stelle ist Veränderung möglich und betrifft nicht nur den Sender oder Vermittler des Modells und den Empfänger, sondern auch die Situation, in der die Translation stattfindet. Von einer „exakten“ Übertragung wird hier nicht ausgegangen, je nach Situation wird das Modell angepasst, mit eigenen Vorstellungen vermischt, Aspekte davon können abgelehnt oder ignoriert werden usw.
Auf die Ethnologie und das „gemeinsame Forschen“ übertragen, könnte die Perspektive auf Travelling Models helfen, die eigenen Vorstellungen und Vorgehensweisen in der Forschung mit den Modellen anderer ForscherInnen zu kombinieren – Modelle zu erkennen und miteinander abzustimmen. Die Modelle zu betrachten beinhaltet, unterschiedliche Prozesse der Wissensproduktion nicht nur zu verstehen, sondern auch die Unterschiede bezüglich der Ansprüche an die Forschung und die epistemologischen Hintergründe aufzugreifen, die im Modell „inskribiert“ sind und diese als gleichwertig zu betrachten. In der Forschung könnte das „reisende Modell der Ethnologie“ z.B. in Form eines Forschungsexposés, eines Methodenplans oder einer Zeitschiene für die Forschung, also aus einem individuell zusammengestellten Set aus Vorgehensweisen, Annahmen und Wissenshintergründen bestehen, die je nach Situation und Interaktion flexibel mit der Fremdheit anderer Diskurse oder Relevanzstrukturen in Verbindung treten. In dieser Verbindung entsteht die Möglichkeit eigene und andere Methoden zu kombinieren, eventuell neue Argumente zu konstruieren und Fragestellungen in Kooperation mit ForschungspartnerInnen zu reformulieren, zu verändern.
Povinelli erzählte in ihrem Vortrag in Estland von einem Filmprojekt, das sie in Australien mit der „Karrabing indigenous corporation“ durchführt. Karrabing ist eine Gruppe von ca. 30 Personen, die vor sieben Jahren aufgrund von Landstreitigkeiten mit einem Bergbauunternehmen heimatlos wurde und die sich daraufhin an einem Ort wiederfand, zu dem sie keine Beziehung hatte. Elisabeth Povinelli stellte ausführlich dar, wie tief ihre Kontakte zu dieser Gruppe seien, mit der sie seit dreißig Jahren zusammenarbeitet. In der Situation dieser Vertreibung saß die Gruppe zusammen mit Povinelli am Strand und der Name „Karrabing“ wurde erfunden. Karrabing bezeichnet die Welle am tiefsten Stand der Ebbe – und dieser Name wurde gewählt, weil er weder mit den ursprünglichen Wurzeln der Gruppe noch mit dem neuen Gebiet, in dem sie jetzt leben würden in Verbindung steht. Es ist ein künstlicher Name, der weder aus- noch einschließen sollte, der jedoch gleichzeitig die prekäre Situation der Gruppe aufgreift.
Der Film „When the dogs talked“ behandelt die Beziehung der Karrabing zur Rohstoffindustrie in ihrem Heimatland. Wie in einer zyklischen Bewegung spiegelt die Landschaft für die Karrabing jedoch nicht nur die heutige Verbindung zur Rohstoffförderung wider sondern auch die Vergangenheit, Kolonialismus und Rassismus. In dem Film streitet eine Gruppe indigener australischer Erwachsener darüber, ob und wie sie ihre Wohnung aus dem öffentlichen Wohnungsbau und die heilige Landschaft retten können, während ihre Kinder gleichzeitig versuchen zu verstehen, wie das von den Ahnen stammende „dog dreaming“ der Landschaft in ihrem heutigen Leben einen Sinn ergeben könnte. Indem sie Hip Hop auf ihren iPods hören, durch das Buschland wandern und in Booten fahren, folgen die Kinder ihren Eltern auf einer Reise die das „Dog Dreaming“ nachspielt. Auf dem Weg geht den Erwachsenen die Kraft aus, Boote haben keinen Sprit mehr und die Kinder drängen die Eltern ihnen zu erklären, warum diese Geschichten überhaupt noch von Bedeutung seien und wie sie im Kontext eines westlichen Verständnisses von Evolution
Das Besondere an dem Film und an der Zusammenarbeit Povinellis mit dieser Gruppe, den „Karrabing“ ist, dass das gesamte Projekt als enge Kollaboration entstanden ist – auf der Basis der extrem vertrauten Beziehung zwischen Forscherin und ihrer australischen „Familie“. Povinelli erklärt, dass ihre Zusammenarbeit, die sie „collaboration“ nennt, als eine Form der Assemblage (im Sinne von Deleuze[1]) zu verstehen sei, die den Kollaborierenden ihre fundamentale Differenz bewusst macht, aber die sie gleichzeitig auch zur Zusammenarbeit verpflichtet. Während dieser „collaboration“ gehen beide Seiten dermaßen intensiv aufeinander ein, dass sie sich in bleibender Weise verändern und diese Veränderung („alteration“) zu einer neuen Form der Erforschung des Eigenen und des Anderen führt („investigation“). Das Filmemachen mit den Karrabing ist nicht die eigentliche Kollaboration, sondern die Filme selbst untersuchen als Kollaborationsform eine Form der Veränderung der Personen, die darin mitspielen. Die Karrabing spielen sich also selbst auf eine Weise, wie sie sich in der Realität verhalten würden. Sie wollen aber, so Povinelli, dass es so aussehe wie eine der angesagten Soap Operas in Australien. So unterhalten sich die Männer, Frauen und Jugendlichen über die Bedeutung des Landes und ihrer Stellung darin – und während dieser Unterhaltung (die für den Film inszeniert wurde), erleben die SchauspielerInnen – und diejenigen, die den Film drehen – eine Veränderung an sich selbst.
Das gemeinsame Forschen beinhaltet bei Povinelli also ein extremes Ineinandergreifen von verschiedenen Positionen z.B. während der Produktion eines Films, der davon handelt wie sich die Protagonisten ihre Position in ihrer unmittelbaren Umgebung, aber auch in einem historischen und globalen Kontext erklären. Was mich an diesem Projekt und Povinellis Darstellung faszinierte, war die Momente der Translation, die die Akteure durch ihre Offenheit gegenüber den gegenseitigen Ansprüchen, Meinungen und Interpretationen während der Entstehung des Films als gemeinsamer Erforschung erlebten – und die Feststellung, dass sich in einem so engen Prozess der Zusammenarbeit beide Seiten notwendigerweise ändern, etwas vom Anderen annehmen und diese Veränderung gleichzeitig zur weiteren Erforschung einsetzen können.
Was hat Povinellis Versuch mit dem Titel dieses Vortrags zu tun? Meines Erachtens hat sie versucht, gemeinsam zu forschen und die Stimme der Anderen so prominent wie möglich in ihre Arbeit einzubringen. Selbstverständlich ist es dennoch „ihre Arbeit“, die dieses Projekt mit initiiert und bekannt gemacht hat. Und selbstverständlich ist es auch „ihr Geld“, das die Arbeit überhaupt möglich gemacht hat. Ich finde aber, dass sie trotz dieser, man könnte sagen, strukturellen Gegebenheiten, eine möglichst große Offenheit gegenüber ihren Partnern in der Forschung zeigte – so zumindest mein Eindruck nach dem Vortrag in Tallinn. Die Arbeit von Povinelli ist nur möglich, wenn sich die gemeinsam Forschenden sehr gut kennen. Wenn ein Verständnis und Vertrauen vorhanden ist, das auch Dinge, die eventuell ansonsten verborgen blieben, gesagt, gezeigt oder diskutiert werden. Dass diese Form des Vertrautseins und intensiven Miteinanders nicht in jeder Forschung möglich ist, werde ich zum Ende des Vortrags noch einmal ansprechen.
Gemeinsam forschen geht also darüber hinaus, in der Veröffentlichung der Arbeit den InformantInnen zu danken. Tim Ingold (2007) spricht in dieser Hinsicht von einem „studieren mit“ anstelle eines „Studierens über“ in seinem Versuch, ethnographische und theorieleitende ethnologische Forschung voneinander zu unterscheiden. Er sagt: „Anthropologists work and study with people. Immersed with them in an environment of joint activity, they learn to see things (or hear them, or touch them) in the ways their teachers and companions do“ (ibid.: 82) .. und mit teachers und companions meint er die „zu Erforschenden“… thinking „with the world“ not about the world (ibid.: 88). Studierende der Ethnologie schließt er in diese Gemeinsamkeit mit ein, wenn sie z.B. in Seminaren zusammen mit den Lehrenden deren Forschungsergebnisse durchdenken. Ingold sagt: „locked out of the power-house of anthropological knowledge construction, all they can do is peer through the windows that our texts and teachings offer them“ (ibid.: 89) und reflektiert, dass die früher als „natives“, später als „informants“ bezeichneten Personen erst seit kürzester Zeit in diesem „big anthropology house“ zugelassen sind, als „master-collaborators, that is as the people we work with“ (ibid.). Tim Ingold spricht in diesem Aufsatz allerdings nicht von den Interaktionen mit lokalen WissenschaftlerInnen im Forschungsgebiet sowie deren Epistomologien und Prozessen der Wissensproduktion.
In Bezug auf dieses Verhältnis halte ich das 2001 erschienene Buch „Georges Woke up Laughing“ von Nina Glick Schiller und Georges Eugene Fouron für ein sehr gutes Beispiel einer solchen Zusammenarbeit – beide Autoren reflektieren hier ihre persönlichen Migrationshintergründe (Nina Russland und George Fouron Haiti) und befassen sich gemeinsam mit den transnationalen Nationalismus von Haitianern in den Vereinigten Staaten. Das Produkt ist genau die Form von Kooperation und gegenseitiger Veränderung, die wohl auch in Povinellis Sinne wäre.
2011 haben die Comaroffs das Thema aufgegriffen in ihrem Buch über „Theory from the South“, das in postkolonialer Rhetorik den kritischen Standpunkt aller Theorie hervorhebt – und im Sinne der Kritik die zunehmende Notwendigkeit des Nordens sich mit der Perspektive des „Südens“ auseinanderzusetzen, weil sich gerade im Süden die Auswirkungen der globalen Weltordnung in besonders ausgeprägter Form zeigen. Sie behaupten der „Süden“ habe sich zu lange den „unbezahlbaren Luxus“ geleistet, sich nicht theoretisch zur globalen Weltordnung zu äußern und sich deren „securities and insecurities, possibilities and impossibilities and its inclusions and exclusions “ als zunehmend dringenden Themen anzunehmen. Der „Süden“, so die Comaroffs, ist nicht mehr der rohe Boden der Fakten, die von „nördlichen“ WissenschaftlerInnen gesammelt werden – sondern bietet die Möglichkeit zur kritischen Reaktion, die sich aus dem Leben und dessen Reflektion, Abstraktion und Generalisierung ergeben kann. Und obwohl die Comaroffs genau den „postkolonialen Nerv“ treffen, den auch Wissenschaftler wie Achille Mbembe immer wieder betonen – wird an ihrem Ansatz kritisiert, dass sie zwar anstreben, als (weiße) Südafrikaner eine kritische „theory from the south“ zu produzieren, diese jedoch – wie auch das Land Südafrika an vielen Stellen selbst – „geschmackvoll für den Norden verpackt haben“ (Allsobrook 2014).
Aktuelle Forschungen im deutschsprachigen Umfeld
Im Rahmen der Afrikaforschung an deutschen und Schweizer Ethnologieinstituten gibt es gerade mehrere Forschungsinitiativen, die genau diese Themen der „theories from the south“ zentral betrachten wollen. Ich möchte drei von ihnen kurz vorstellen: Mamadou Diawara, Elisio Macamo und eine Gruppe von internationalen WissenschaftlerInnen führen im Rahmen der Initiative Point Sud eine Reihe von Tagungen durch mit dem Thema: Afrika Nko – Speaking of Africa in the World and Redefining the Social Sciences and Humanities. Die Organisatoren der Tagungen gehen davon aus, dass die Wissensproduktion über Afrika zum einen vom „Westen“ in ungleicher Weise aufgestellt wurde und zum anderen davon geprägt ist, dass „Stimmen aus Afrika“ dieses Wissen kritisch hinterfragt haben. Sie verlangen, „einen Schritt weiter zu gehen“: Mit dem Stichwort der „epistemologies of the south“ von Boaventura de Sousa Santos kritisieren die Autoren, dass das Wissen, das wir heute über Afrika haben, nicht unbedingt der lebensweltlichen Erfahrung vieler AfrikanerInnen entspricht. Ihr Ziel ist es daher zum einen, die „afrikanische wissenschaftliche Souveränität zurück zu erlangen“ und auf der anderen Seite darüber nachzudenken, welchen Beitrag diese Souveränität zu einer Redefinition der Sozialwissenschaften beitragen kann.
In einer wissenssoziologisch angelegten Forschung planen Rosemarie Beck, Sung-Joon Park und Markus Höhne hier in Leipzig ein Projekt, das die Übersetzung von Wissenschaftsmodellen in afrikanischen Wissenschafts- und Forschungsinstitutionen erforschen möchte. Sie sagen, dass die Zukunft von Wissenschaft auf dem afrikanischen Kontinent im Rahmen einer Kluft zwischen afrikanischer Wissenschaft und der Entstehung einer globalen Wissensgesellschaft kontrovers artikuliert wird. Ganz im Sinne der „Travelling Models“ plant dieses Projekt einen konzeptionellen Beitrag zu diesen Kontroversen, in dem sie Wissen im Verhältnis zum Ort seiner Produktion in den Blick nehmen. Mit dem Fokus auf Curricula gehen die drei davon aus, dass translokal zirkulierende Personen, Objekte, Artefakte, Narrative und Technologien in historisch und gesellschaftlich ausgeprägte Wissensökologien (ecologies of knowledge) übersetzt werden.
Angesiedelt am Seminar für Ethnologie der Uni Halle und dem WISER Institut in Johannesburg begann vor einigen Monaten ein Forschungsnetzwerk, das sich mit Science and Technology Studies in Afrika auseinandersetzt. Unter dem Namen STS-Africa nehmen sich die TeilnehmerInnen zum Ziel, im Austausch mit afrikanischen WissenschaftlerInnen den momentanen euro-amerikanischen Fokus der STS Studien auf afrikanische Themen auszuweiten.
Ausblick: Kreativität der ethnologischen Praxis
Hier endet mein Versuch, die Ethnologie als „reisendes Modell“ in der Forschungspraxis und der Wissensproduktion zu durchdenken. Auch wenn es sich so anhört, waren die Vorschläge nicht normativ gemeint. Es ist mir klar, dass die intensive Form der gemeinsamen Forschung, wie Povinelli sie in Tallinn vorgestellt hat, nicht immer möglich ist. Ich möchte, um das zu betonen, mit einer letzten Geschichte enden. In Tallinn sprach ich mit Jan Beek, inzwischen promovierter ehemaliger Doktorand der Ethnologie aus Mainz über die Frage von Julia Eckerts Student nach der Berechtigung der Forschung in anderen Ländern. Jans Forschung über – zum Teil sehr brutale – Praktiken der Polizei in Nordghana hat ihn vor ein Dilemma gestellt. Kollaboration hat in seinem Forschungsfeld, wie er meinte, eine ganz andere Bedeutung bekommen: Im Sinne der Forschung gewalttätigen Praktiken beizuwohnen, die im eigenen moralischen Sinne abstoßend sind, grenzt an Mittäterschaft und Verrat der eigenen Wertvorstellungen. In einem rigorosen Statement meint er daher: „Ich finde, es geht nicht um Berechtigung zu forschen. Ethnographische Forschung ist spannend, wenn sie sich nicht moralisch rechtfertigt (gegenüber den Erforschten) noch versucht nützlich zu sein (gegenüber Geldgebern und Experten). Nur ohne normative Vorgaben klappt Multiperspektivität, Kontingenzerfahrung und Theorieproduktion.“[2]
Ich erhebe mit diesem Vortrag nicht den Anspruch, Neuland zu betreten, weit davon entfernt. Sie alle hier haben in unterschiedlicher Weise mit WissenschaftlerInnen aus ihren Forschungsländern zusammen gearbeitet, gemeinsam geforscht und gemeinsam publiziert. Was ich heute als „Zukunft der Ethnologie“hervorheben möchte ist eben diese Aufmerksamkeit für die unterschiedliche Konstruktion von Wissen, für unterschiedliche Relevanzstrukturen, und die Möglichkeit Wissen kreativ gemeinsam zu produzieren.
Fußnoten
[1]Deleuze und Guattari haben um den Begriff „assemblage“ eine sozialwissenschaftliche Theorie konstruiert. Sie verstehen unter „Assemblage“ ein „kontingentes Ensemble von Praktiken und Gegenständen, zwischen denen unterschieden werden kann“ (d. h. sie sind keine Ansammlungen von Gleichartigem), „die entlang den Achsen von Territorialität und Entterritorialisierung ausgerichtet“ werden können. Damit vertreten sie die These, dass bestimmte Mixturen technischer und administrativer Praktiken neue Räume erschließen und verständlich machen, indem sie Milieus dechiffrieren und neu kodieren.
[2] Zu diesem Thema ist ein Aufsatz von Beek und Göpfert (2013) erschienen, die das Dilemma der “Kollaboration” von der problematischeren Seite betrachtet.
Zitierte Quellen
Allsobrook, Christopher 2014. Review of „Theory from the South“ by Jean and John Comaroff.
Beek, Jan & Mirco Göpfert 2013. State Violence Specialists in West Africa. Sociologus: Vol. 63, Bureaucrats in Uniform, 103-124.
Behrends, Andrea, Sung-Joon Park & Richard Rottenburg 2014. Travelling models. Introducing an analytical concept to globalisation studies. In Travelling Models in African Conflict Management. Translating Technologies of Social Ordering, edited by Behrends, Andrea, Sung-Joon Park & Richard Rottenburg. Leiden: Brill, 1-40.
Comaroff, Jean & John L. Comaroff 2011. Theory from the South, or, How Euro-America is evolving toward Africa. Boulder, CO: Paradigm Publishers.
Glick-Schiller, Nina & Georges Eugene Fouron 2001. Georges woke up laughing: Long distance nationalism and the apparent state. Durham: Duke University Press.
Ingold, Tim 2007. Anthropology is Not Ethnography. Proceedings of the British Academy no. 154: 69-92.
Povinelli, Elisabeth 2014. Collaboration, Alteration, Investigation. Keynote address at 13th Biannual EASA Conference, 31 July – 3 August 2014, Tallinn.
Rottenburg, Richard 2009. Far-fetched facts: a parable of development aid. Cambridge, Mass.: MIT Press.